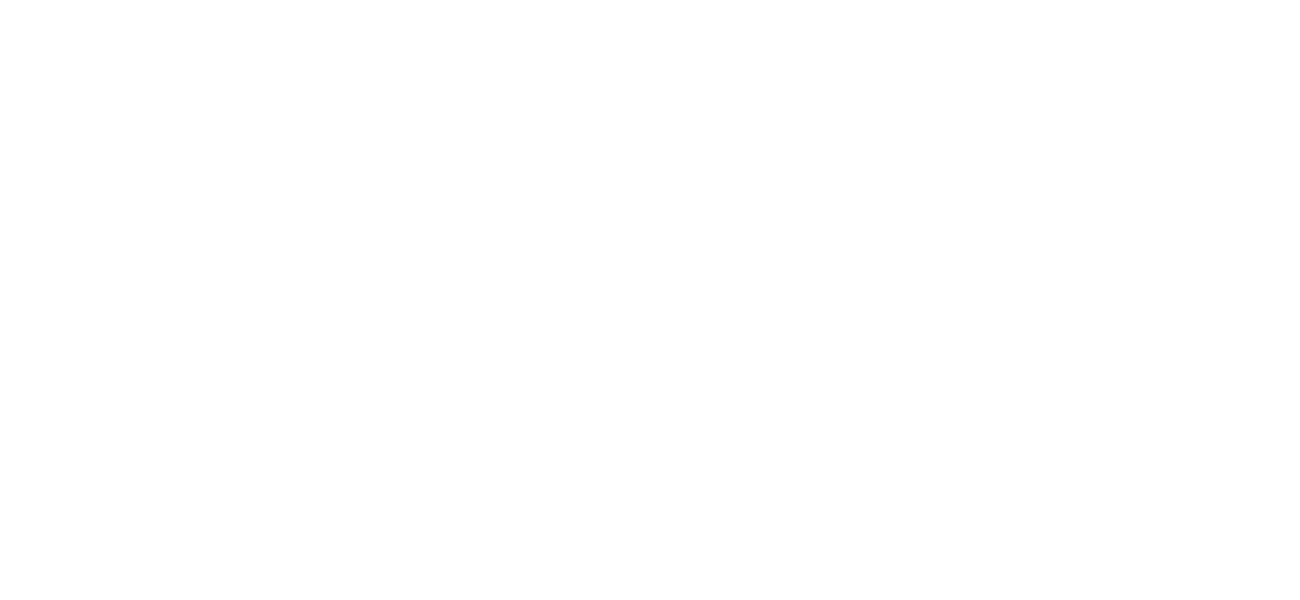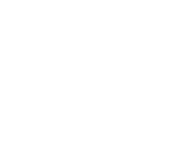Pellet-Lexikon
Die Welt der Pellets im Fokus
Abrieb
Der Abrieb entsteht durch mechanische Einwirkungen bei der Lagerung, dem Transport und dem Einblasen von Holzpellets. Er besteht aus Feinanteil, d.h. Partikel bis unter 3,15 mm Länge, und ist das Gegenstück zur mechanischen Festigkeit.
Absaugstutzen
Stutzen („Storz Typ A“, DN 100), Durchmesser i. d. R. 100 mm, an dem das Absauggebläse des Pelletlieferanten angeschlossen wird. Während des Befüllvorgangs wird die Luft aus dem Lager abgesaugt. Ausnahmen bilden Gewebesilos mit luftdurchlässigem Gewebe.
Ascheerweichungstemperatur
Die Ascheerweichungstemperatur beschreibt die Temperatur, bei der die Asche beginnt, weich und teigig zu werden. Kühlt diese Asche wieder ab, wird sie hart. Dann spricht man von Versinterung bzw. Verschlackung der Asche. Die versinterte Asche sammelt sich im Brennertopf der Anlage und stört den Heizungsbetrieb. Zertifizierte ENplus-A1-Pellets müssen eine Ascheerweichungstemperatur von mind. 1.200 °C besitzen und damit eine Anforderung erfüllen, die in der Norm gar nicht vorgeschrieben ist.
Aschegehalt
Der Aschegehalt ist die Menge an Verbrennungsrückstand, die beim Verbrennen eines Brennstoffes entsteht. ENplus-A1-zertifizierte Pellets zeichnen sich durch einen geringen Ascheanteil von maximal 0,7 Prozent aus. Ein niedriger Aschegehalt erhöht den Heizkomfort, verringert zudem die Freisetzung von Emissionen beim Heizen und entlastet somit das Klima. Die Asche von Kleinfeuerungsanlagen kann über den Hausmüll entsorgt werden. Weiterführende Informationen zur Ascheentsorgung.
ATEX
Französische Abkürzung für ATmospheres EXplosibles. Wird synonym für die ATEX-Richtlinien der EU für Explosionsschutz verwendet. Pelletlager sind in der Regel der ATEX-Zone 22 zugeordnet.
Aufstellraum für die Feuerstätte
Der Aufstellraum für den Pelletkessel als Zentralheizung ist in der Regel ein Kellerraum. Ein Pelletlager in nächster Nähe zum Kessel sorgt für kurze Transportwege. Übrigens: Pelletkaminöfen eignen sich zur Beheizung einzelner Wohnräume. Diese werden im jeweiligen Raum aufgestellt. Somit kann in nahezu jedem Objekt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt mit Holzpellets geheizt werden.
Austauschpflicht
Für Öl- und Gas-Konstanttemperaturkessel (auch Standardkessel genannt) mit einer Nennwärmeleistung von 4-400 kW, die mindestens 30 Jahre alt sind, gilt ein Betriebsverbot. Das schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in § 72 in den Absätzen 1 bis 3 vor. Da die meisten Gebäude weitergenutzt werden sollen, wenn das Betriebsverbot greift, wird in aller Regel ein neuer Wärmeerzeuger eingebaut. Deshalb wird dieses Betriebsverbot für mehr als 30 Jahre alte Öl- und Gaskessel oft auch als Austauschpflicht bezeichnet. Ausgenommen sind Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die ihr Haus am 1. Februar 2002 selbst bewohnt haben. Diese Gebäude entgehen mittelfristig trotzdem nicht der Austauschpflicht: Nach einem Verkauf oder einer Vererbung greift das Betriebsverbot auch bei ursprünglich ausgenommenen Gebäuden. Es gilt dabei eine Übergangsfrist von zwei Jahren, innerhalb derer der Austausch vorgenommen werden muss.
Austragssystem
Einrichtung zur Entnahme der Pellets aus dem Lager. Kann auch den Transport der Pellets zur Feuerung beinhalten.
Automatische Beschickung
Befüllung
Mit Befüllung ist der Transport des Brennstoffs in den Vorlagebehälter einer Feuerungsanlage gemeint. Diese erfolgt bei Pelletkesseln meist automatisch aus einem Pelletlager z. B. einem flexiblem Pelletsilo und bei Pelletkaminöfen meist per Hand (Handbefüllung).
Belüftender Deckel
Dienen der „Deckellüftung“ und sorgen durch regen- und spritzwassergeschützte Öffnungen für einen ausreichenden Luftaustausch im Lager bei einer Lüftungsdistanz ≤ 2 m bzw. individueller Berechnung nach DIN EN ISO 20023.
Beschickung des Brennraums
Bei der Beschickung des Brennraums geht es um den Transport des Brennstoffs in den Brennraum. Diese erfolgt bei Pelletkesseln immer automatisch (automatische Beschickung), meist mit einer Förderschnecke. Bei Scheitholzkesseln hingegen wird der Brennstoff per Hand in den Brennraum gelegt, weshalb diese zu den handbeschickten Anlagen gezählt werden.8
Biomasse
Im Energiesektor wird unter Biomasse der Stoff verstanden, der zur Gewinnung von Bioenergie benötigt wird. Alle durch Pflanzen, Tiere und Menschen produzierten organischen Erzeugnisse, die im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor zur Energiegewinnung eingesetzt werden können, werden zur Biomasse gezählt. So werden beispielsweise Holzpellets aus fester Biomasse (Holz) gepresst und anschließend zur Wärmegewinnung verwendet. Rein physikalisch gesehen kann Biomasse mit chemisch gebundener Sonnenenergie gleichgesetzt werden, da Pflanzen mittels Photosynthese Sonnenenergie in energetisch nutzbare Formen umsetzen. Auch tierische Biomasse ist letztendlich auf die in Pflanzen gespeicherte Energie zurückzuführen, da Pflanzen die Basis der Nahrungskette bilden. Bioenergie aus Biomasse nimmt unter den Erneuerbaren Energien eine essentielle Stellung ein, da sie sich sehr gut speichern lässt und daher bedarfsgerecht genutzt werden kann. Weiterführende Informationen zum Kreislauf Holzenergie
Brandschutz
Brennstoff
Mit dem Verwendungsnachweis (VN) ist die Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben (BwA) mit einzureichen. Das Formular dazu wird dem
Antragsteller vorausgefüllt zusammen mit ZWB und dem VN-Formular zugesendet.
Brennwert
Der Brennwert ist die Energie, die bei einer vollständigen Verbrennung von Brennstoffen abgegeben wird, einschließlich der durch Kondensation des entstandenen Wasserdampfes freiwerdenden Energie. Der Brennwert beinhaltet demnach den Heizwert und die sogenannte Kondensationswärme. Daher kann der Wirkungsgrad mehr als 100 Prozent des Heizwertes betragen. Der Brennwert wird auch als „oberer Heizwert“ (HO oder HS) bezeichnet.
Daher sollte immer klar sein, ob sich Wirkungsgradangaben auf den Brenn- oder Heizwert beziehen.
Brennwert = Heizwert + Kondensationsenergie
CO2-Bilanz
Das Heizen mit Holzpellets ist nahezu CO2-neutral. Die Verbrennung von Pellets setzt genau die gleiche Menge CO2frei, die das wachsende Holz zuvor aus der Luft gebunden hat. Heizen mit Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung schließt also den CO2-Kreislauf.
CO2-neutral
Der Begriff CO2-neutral bezeichnet Prozesse, bei denen die Menge an CO2 in der Atmosphäre, über einen längeren Zeitraum betrachtet, nicht verändert wird. Aus Pflanzen gewonnene, nicht-fossile Brennstoffe wie Ethanol, Rapsöl und Holz erfüllen dieses Kriterium bei nachhaltiger Erzeugung, denn sie geben bei der Verbrennung nur das Kohlendioxid ab, das sie während des Wachstums aufgenommen haben. Weiterführende Informationen zur CO2-neutralen Verbrennung
CO2-Preis (CO2-Bepreisung)
In der Handelsphase ab 2026 wird sich der CO2-Preis hingegen auf Basis einer Emissionsobergrenze als Marktpreis nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage bilden. Dabei wird es 2026 einen Mindestpreis von 55 Euro pro Tonne und einen Höchstpreis von 65 Euro pro Tonne geben. Ob es auch in den Jahren ab 2027 CO2-Mindest- und Höchstpreise geben wird, ist noch nicht entschieden. Auch im Brennstoffemissionshandel wird die Höhe des CO2-Preises und damit die Wirksamkeit für den Klimaschutz ab 2027 im Wesentlichen durch die politisch gesetzte Emissionsobergrenze, das sog. „Cap“, bestimmt werden.
DEPI
Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) wurde im Jahr 2008 mit Sitz in Berlin als Tochterunternehmen des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands e. V. (DEPV) gegründet und bündelt die Bereiche Kommunikation, Information, PR und Marketing rund um das Thema Heizen mit Holzpellets.
DEPV
Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV) vertritt als Bundesverband die deutsche Pellet- und Holzenergiebranche. Als Wirtschaftsverband übernimmt er die politische Interessenvertretung für Unternehmen rund um das Heizen mit Holzpellets und moderne Holzenergie auf Bundes- und Landesebene.
EEWärmeG
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) soll den Ausbau erneuerbarer Energien im Wärme- und Kältesektor bei der energetischen Gebäudeversorgung vorantreiben. Das Gesetz trat im Januar 2009 in Kraft und ist Teil des von der Bundesregierung beschlossenen Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP). Es führt erstmals eine Pflicht zur Verwendung von erneuerbaren Energien beim Neubau von Gebäuden ein.)
Effizienshaus (EH)=KfW-Effizenzhaus
Ein Effizienzhaus (EH) ist nach den Festlegungen der BEG Wohngebäude ein Wohngebäude, das bezogen auf den Primärenergieverbrauch des im Gebäudeenergiegesetz (GEG) definierten Referenzgebäudes (= 100 Prozent) einen bestimmten prozentualen Energiestandard erreicht. Das Effizienzhaus 55 etwa hat einen Primärenergieverbrauch von höchstens 55 Prozent des Referenzgebäudes. Die zulässigen Transmissionswärmeverluste der Gebäudehülle liegen jeweils 15 Prozentpunkte darüber. Im Rahmen der Effizienzhausförderung der BEG Wohngebäude gibt es eine Förderung für folgende Effizienzhäuser: im Gebäudebestand EH 40, EH 55, EH 70, EH 85, EH 100 und EH Denkmal, und im Neubau EH 40 Plus, EH 40 und EH 55. Beim EH Denkmal sind 160 Prozent des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes zulässig. Eine Mindestanforderung für den Transmissionswärmeverlust der Gebäudehülle gibt es für die energetische Modernisierung von Denkmalen nicht.
Effiziensgebäude (EG)
Einblasstrecke
Einblaspauschale
Einzelraumfeuerungsanlage
Endenenergiebedarf
Energieausweis
Energiebedarf
Energieeffizienzklasse für Wohngebäude
Energieverbrauch
EnEV
ENplus
Erdtank
Erneuerbare Energie
Fassungsvermögen
Kapazität des Lagers; Masse an Pellets in t, die rechnerisch in das Lager passen. Schüttdichte, Füllhöhe und Leervolumen im Lager müssen berücksichtigt werden.
Feinanteil
Als Feinanteil von Holzpellets werden Partikel bezeichnet, die kleiner als 3,15 Millimeter sind. Ein zu hoher Feinanteil wirkt sich ungünstig auf die Verbrennung aus und kann in vielen Fällen die Ursache für Störungen der Heizungsanlage sein. Daher wird der Feinanteil bei der ENplus–Zertifizierung geprüft und darf bei ENplus-zertifizierter Sackware 0,5 Prozent und im Pelletlager beim Kunden 4 Prozent nicht übersteigen. Pellets sollten schonend eingeblasen werden, damit wenig Feinanteil entsteht. Zertifizierte Pellethändler sind darin erfahren. Feinanteil kann aber auch bei der Befüllung schlecht gebauter Lager entstehen. Pelletlager sollten daher den Bestimmungen der Broschüre Lagerung von Holzpellets entsprechen.
Feinstaub
Feinstaub besteht aus kleinsten Schwebstoffen aus natürlichen und von Menschen verursachten Quellen in der Luft. Dazu zählen alle festen und flüssigen Teilchen, die so klein sind, dass sie nicht sofort zu Boden sinken. Diese feinen Partikel werden von den Schleimhäuten im Nasen- und Rachenraum bzw. den Härchen im Nasenbereich nur bedingt zurückgehalten und können deshalb gesundheitsgefährdend sein. Die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImschV) regelt die Staubemissionen von Heizungsanlagen durch sehr strenge Grenzwerte. Die Emissionen von modernen Pelletheizungen liegen aufgrund des trockenen und homogenisierten Brennstoff unter den zum 1. Januar 2015 mit Inkrafttreten der 2. Stufe der 1. BImSchV nochmals verschärften Staubgrenzwerten. Pelletheizungen tragen somit nicht zur Feinstaubproblematik bei. Feinstaub wird in drei Größenklassen eingeteilt PM10 (PM, particulate matter) mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (µm), PM2,5 und ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm. Weiterführende Informationen zur 1. BImSchV auf der DEPV-Webseite
Festbrennstoff
Festbrennstoff ist ein Brennstoff, der in Abgrenzung zu flüssigen und gasförmigen Brennstoffen fest ist. Dazu gehören die verschiedenen Holzbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz), aber auch Braun- und Steinkohle.
Feuchtegehalt
Der Feuchtegehalt gibt prozentual an, wie viel Wasser in Bezug auf die Trockenmasse (null Prozent Wasser) im Holz vorhanden ist. Je geringer der Wert, desto abgasärmer und rußfreier läuft die Verbrennung ab. Der Feuchtegehalt unterscheidet sich jedoch vom Wassergehalt und ist für Pellets nicht ausschlaggebend. In der ENplus-Zertifizierung gibt man daher einen Grenzwert für den Wassergehalt an. Feuchtegehalt = Gewicht des Wassers / Gewicht der absolut trockenen Holzmasse (kein Wasser vorhanden).
Feuerung
Eine Feuerung ist ein Wärmeerzeuger, sie setzt einen Brennstoff zur Erzeugung von Wärme, Strom oder auch von Strom und Wärme gleichzeitig (Kraft-Wärme-Kopplung) ein.
Dazu gehören u.a. Heizkessel und Einzelraumfeuerungsanlage.
Feuerungsverordnung
Feuerungsverordnungen (FeuVO) der Bundesländer regeln die Anforderungen an den Brandschutz von Feuerung, deren Aufstell- oder Heizräumen, die Verbrennungsluftversorgung, die Abgasanlagen sowie die Brennstofflagerung (auch die Lagerung von Pellets). Jedes Bundesland in Deutschland hat hierfür eigene Vorgaben, die sich an der Musterfeuerungsverordnung (MFeuV) des Bundes orientieren.
FFP
Englische Abkürzung für Filtering Face Piece; bezeichnet die Filterklasse. Beim Reinigen des Pelletlagers ist eine Staubmaske der Filterklasse FFP2 zu tragen.
Förderschnecke
Um Holzpellets aus dem Pelletlager z. B. flexiblen Pelletsilo in einem Pelletkessel oder Pelletkaminofen zu transportieren (Raumentnahme/Raumaustragung), ist der Einsatz einer Förderschnecke die gängigste Form. Bei der automatischen Beschickung des Brennraums bei automatisch beschickten Festbrennstofffeuerungen kommen ausschließlich Schnecken zum Einsatz. Dabei dreht sich in einem Rohr eine Wendel („Schnecke“), welche die Pellets kontinuierlich aus dem Lager in Richtung Kessel transportiert. Dieses Modell nennt sich Schnecke mit Seele. Wird auf die Wendel verzichtet, bezeichnet man das Fördersystem als seelenlos. In diesem Fall wird die stabilisierende Wirkung der starren Welle durch Profile erzielt, die in die Spirale eingearbeitet sind. Für Schneckensysteme ist der Einsatz von qualitativ hochwertigen Holzpellets mit geringem Feinanteil besonders wichtig, da Kleinteile die Förderschnecke verstopfen können. Wichtig: Förderschnecken eignen sich nur für Lager, die unmittelbar neben der Heizung liegen. Eine andere Möglichkeit zur automatischen Beschickung von Pelletfeuerungen, die sich besser für weiter von der Heizung entfernte Lager eignet, ist die Saugentnahme/Saugaustragung.
Fördersystem
Einrichtung zum Transport von Pellets von mind. 30t bzw. mit häufigen Belieferungen.
Gebäude-Energieeffizienzklasse
siehe Energieeffizienzklasse für Wohngebäude
Gebäudewärme
Gebäudewärme ist die Wärme, die von einem Wärmeerzeugern für die Beheizung von Gebäuden bereitgestellt wird. Sie umfasst die Raumwärme für das Beheizen von Gebäuden als auch die Wärme für die Warmwasserbereitung.
Glutbett
Bei der Verbrennung von festen Brennstoffen bildet sich während des Verbrennungsprozesses ein Glutbett. Dieses ist in jedem herkömmlichen Ofen an der Stelle zu finden, an der Brennstoff und Luft miteinander reagieren und Wärme freigesetzt wird. Nach dem Verbrennungsvorgang bildet sich Asche.
Grenzwerte
Grenzwerte gelten sowohl für die Pelletqualität, als auch für die Abgaswerte von Pelletheizungen. Für eine hocheffiziente und saubere Verbrennung ist eine hohe Pelletqualität nötig. Um diese zu erreichen, müssen die Holzpellets bestimmten Grenzwerten genügen, deren Einhaltung durch die ENplus-Zertifizierung sichergestellt wird. Dank der hohen Pelletqualität und modernster Technik erfüllen Pelletfeuerungen ohne Probleme die von der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) vorgegebenen Emissionsgrenzwerte.
Größere Lager
Pelletlager mit einem Fassungsvermögen von mind. 30 t bzw. mit häufigen Belieferungen.
Halbautomatische Feuerungsanlage
Bei halbautomatischen Feuerungen erfolgt die Befüllung eines Vorratsbehälters per Hand aus handlichen 8-15 kg-Pelletsäcken (Sackware) und die Beschickung des Brennraums automatisch. Dies ist bei den meisten Pelletkaminöfen der Fall. Es ist aber auch bei einem Pelletkaminofen der Anschluss an ein Pelletlager möglich, sofern es die räumlichen Verhältnisse zulassen. Pelletkessel werden dagegen meist als vollautomatische Feuerungsanlage ausgeführt. Bei niedrigem Energiebedarf kann auch ein Pelletkessel ausnahmsweise ohne Lager nur mit Handbefüllung des Vorratsbehälters als halbautomatische Feuerungsanlage betrieben werden. Dies kann die anfänglichen Investitionen vermindern. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Feuerung dann gegebenenfalls mit einem Lager sowie einem vollautomatischen Austragssystem ergänzt werden. Mit steigendem Energiebedarf des Gebäudes wird die Befüllung per Hand jedoch immer unpraktischer.
Handbefüllung
Bei Pelletkaminöfen ist meist und auch bei einem Teil der Pelletkesseln eine Handbefüllung des Vorratsbehälters, der in diesem Fall ebenso der Vorlagebehälter sein kann, mit handlichen Pelletsäcken (8-15 kg) (Sackware) möglich. Vom Vorlagebehälter gelangen die Holzpellets vollautomatisch in den Brennraum (automatische Beschickung).
HDPE-Folie
Reiß-, kratz- und verschließfeste Folie; geeignetes Material mit einer abriebarmen Oberfläche für Prallmatten (Englisch: High Density Polyethylen, Deutsch: Hart-Polyethylen).
Heizcontainer
Heizcontainer so wie der von A.B.S. sind mobile Formen der Heizzentrale. Man fasst darunter Container, meist aus Stahl, Stahlbeton oder Holz, in denen ein Wärmeerzeuger (z. B. eine Pelletfeuerung inklusive Fördersystem) installiert ist. Es kann auch bereits ein Lagersystem integriert sein. Die Container werden per Lkw antransportiert und mit einem Kran an die vorgesehene Stelle auf ein Fundament gestellt.
Heizkosten
Unter den Heizkosten werden gemäß Heizkostenverordnung (HKV) diejenigen Kosten verstanden, die für die Bereitstellung von Wärme für die Beheizung von Gebäuden (Raumwärme) und für Warmwasser anfallen. Es handelt sich um die Kosten, die in der Heizkostenabrechnung einer Mietwohnung als Heizkosten abgerechnet werden. Die Heizkosten enthalten die Kosten für den Endenergieträger (z. B. den Brennstoff, Strom oder Fernwärme) und die Kosten für den laufenden Betrieb der Heizungsanlage (Wartung, Reparatur, Schornsteinfeger). Nicht unter die Heizkosten fallen dabei die Kosten für die Investition in die Heizung (bei Mietwohnungen Teil der Miete). Die abgerechneten Heizkosten beruhen demnach nicht auf einer Vollkostenrechnung für die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser.
Heizlast
Die Heizlast ist die Wärmeleistung (Nutzenergie) in Kilowatt (kW), die am kältesten Tag des Jahres benötigt wird, um das gesamte Gebäude warm zu halten. Sie entspricht den Wärmeverlusten des Gebäudes, die bei der angestrebten Raumtemperatur auftreten. Die Auslegung eines Wärmeerzeugers sollte diese Heizlast abdecken können. An milderen Tagen wird entsprechend weniger Wärme erzeugt – entweder durch einen Teillastbetrieb oder eine Zwischenspeicherung der Wärme in einem Pufferspeicher. Als Faustregel für die Heizlast sollten im Gebäudebestand mit mäßiger Dämmung circa 100 bis 130 Watt pro m² Wohnfläche angesetzt werden. Inklusive Warmwasserbereitung sind bei Ein- und Zweifamilienhäusern meist Kessel im Leistungsbereich von 15-25 kW erforderlich. Bei Neubauten, die den Niedrigstenergiegebäudestandard des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einhalten müssen, ergibt sich für Einfamilienhäuser ein geringerer Wärmebedarf. Zumeist werden in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern Kessel oder Öfen mit weniger als zehn kW benötigt. Bei der Dimensionierung des Kessels muss insbesondere bei Häusern mit sehr geringem Wärmebedarf die für die Brauchwassererwärmung erforderliche Leistung gesondert berücksichtigt werden. In der Praxis hat sich daher bei Neubauten eine Kesselleistung von circa 15 kW bewährt.
Heizraum
Der Heizraum bezeichnet den Raum, in dem der Heizkessel steht. Dieser sollte sich möglichst direkt an der Gebäudeaußenwand befinden, um die erforderliche Belüftung zu gewährleisten. Bei einem innenliegenden Heizraum muss ein Lüftungsrohr bis an die Außenmauer geführt werden. Darüber hinaus sollte der Standort der Heizung trocken und frostsicher sein. Ein Wasserhahn für die Nachspeisung von Heizungswasser ist außerdem nötig. Sicherheitshalber sollten Rauchmelder und Feuerlöscher in der Nähe sein. Außerhalb des Raumes muss ein Heizungsnotschalter installiert werden, um im Ernstfall die Anlage von außen abschalten zu können. Wichtig: Für Heizräume mit einer Nennwärmeleistung größer 50 Kilowatt gelten besondere Brandschutzbestimmungen gemäß der jeweils gültigen Landesfeuerungsverordnung. Weiterführende Informationen dazu in der Broschüre Lagerung von Holzpellets – ENplus-konforme Lagersysteme
Heizwert
Der Heizwert bezeichnet die bei der Verbrennung von Brennstoffen abgegebene Wärmemenge ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wassers. Der Heizwert von Holzpellets liegt bei ungefähr 4,9 kWh pro Kilogramm. Damit entsprechen zwei Kilogramm Pellets etwa einem Liter Heizöl, weshalb der klimafreundliche Brennstoff auch kleiner Energieriese genannt wird. Heizwert = Brennwert – Kondensationsenergie.
Heizzentrale
Eine Heizzentrale ist ein Anbau oder Nebenhaus, in dem der Wärmeerzeuger (z. B. eine Pelletfeuerung), die Abgasanlage und das Lager für den Brennstoff (z. B. Holzpellets) und weitere Systemkomponenten untergebracht sind. Die Heizzentrale hat die Funktion, umliegende Gebäude oder Teile davon zentral mit Wärme zu versorgen.
Holzpellets
Holzpellets sind genormte zylindrische Presslinge aus naturbelassenen Sägespänen, die im holzverarbeitenden Gewerbe anfallen. Um den Brennstoff herzustellen, wird das Rohmaterial – Säge- und Hobelspäne sowie unbehandelte Resthölzer aus der Holzindustrie – unter hohem Druck ohne chemische Bindemittel in Form gepresst. Die Einhaltung der Norm DIN EN ISO 17225-2 für Holzpellets wird durch die ENplus–Zertifizierung sichergestellt. Holzpellets mit dem ENplus-Siegel sind ein standardisiertes Produkt mit einheitlicher Qualität. Zur Qualitätssicherung wird die gesamte Lieferkette vom Produzenten bis zum Verbraucher mit jährlichen Inspektionen überwacht. Holzpellets können nur in dafür freigegebenen geeigneten Geräten wie Pelletkessel oder Pelletkaminöfen verfeuert werden.
Hybridheizung
Eine Hybridheizung (auch Hybridanlage) ist im Gegensatz zu einer monovalenten (einzeln betriebenen) Heizung ein System zur Wärmeerzeugung, das zwei oder mehr Energiequellen kombiniert. Es hilft, die erzeugte Wärmeenergie mehrerer Energiequellen im zentralen Wärmespeicher zu sammeln. Oft reicht die Warmwasserversorgung einer Solarthermieanlage im Sommer aus. Für die Wintermonate kann dann beispielsweise ein Pelletkessel zur Beheizung des Hauses hinzugezogen werden. In Passivhäusern kann ein wassergeführter Pelletkaminofen mit Solarthermie kombiniert werden. Ebenso ist die Kombination einer Pelletfeuerung mit einer Warmwasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe möglich.
Ein Beispiel für eine Hybridheizung finden Sie bei uns im Unternehmen. Hier geht´s zum Beitrag.
Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich ist eine entscheidende Voraussetzung für die effiziente Wärmeverteilung im Gebäude. Dafür wird das Heizsystem so eingestellt, dass jeder Heizkörper im Haus mit genau der Wärmemenge aus dem Heizkessel versorgt wird, die er benötigt – unabhängig davon, wie weit er vom Kessel entfernt ist. Bei Heizungen ohne hydraulischen Abgleich wird die Heizenergie weniger effizient genutzt, weil näher am Kessel gelegene Heizkörper heißer werden als solche, die weiter entfernt sind. Der hydraulische Abgleich reduziert damit nicht nur den Energieverbrauch, sondern steigert auch den Wohnkomfort.
Jahresverbrennungsbedarf
Der Jahresbrennstoffbedarf entspricht der Energiemenge, die ein Haushalt zum Heizen und für die Warmwasserbereitung benötigt. Ein Haushalt mit einem theoretischen Heizölverbrauch von 2.000 Litern pro Jahr benötigt demnach vier Tonnen Holzpellets.
Jahresnutzungsgrad
Der Jahresnutzungsgrad gibt an, wie viel Prozent der in Holzpellets enthaltenen Energie während einer Heizperiode in nutzbare Heizwärme umgewandelt wird. Die im Jahresverlauf wechselnden Temperaturen und Heizbedingungen werden dabei berücksichtigt, indem Kesselwirkungsgrade bei verschiedenen Betriebsstufen ermittelt werden und mit ihrem Zeitanteil in die Rechnung eingehen. Im Gegensatz zum Wirkungsgrad berücksichtigt der Jahresnutzungsgrad verschiedene, mit unterschiedlichen Verlusten behaftete Betriebszustände über das gesamte Jahr. Während der Nutzungsgrad des Kessels nur die Kesselverluste berücksichtigt, beinhaltet der Jahresnutzungsgrad der gesamten Heizanlage zusätzlich die Verluste der Wärmeverteilung.
Joule
Joule (J) ist eine internationale Einheit für Energie, Arbeit und Wärmemenge. Benannt wurde sie nach dem britischen Physiker James Prescott Joule. Ein Joule entspricht der Energie, die benötigt wird, um a) um 100 Gramm um einen Meter anzuheben, oder b) die Leistung von einem Watt für die Dauer von einer Sekunde aufzuwenden. Ein Joule wird daher auch als Wattsekunde bezeichnet. Aus Gründen der Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit empfiehlt es sich jedoch für die Anwendung im Heizungsbereich, Energiemengen in Kilowattstunden (kWh) anzugeben. Umrechnung: 1 Joule = 1 Wattsekunde 3,6 Megajoule = 1 Kilowattstunde
Industrieholz
Als Industrieholz wird Rund- bzw. Waldholz bezeichnet, das vom Stammumfang oder der Qualität her nicht zu Schnittholz weiterverarbeitet werden kann. Es wird stattdessen in der Holzindustrie mechanisch zerkleinert oder chemisch aufgeschlossen, um zu verschiedenen Holzprodukten weiterverarbeitet zu werden, z. B. zu Holzwerkstoffen wie Holzwolle oder Span- und Faserplatten oder in der Zellstoffindustrie zu Papier. Es kann aber auch zur Herstellung von Holzpellets genutzt werden und macht etwa 10 Prozent des Rohstoffs der Pelletproduzenten in Deutschland aus. Aus Kostengründen wird als Ausgangsmaterial jedoch Sägerestholz bevorzugt.
Industriepellets
Industriepellets eigenen sich zum Einsatz in Großanlagen oder in Heizkraftwerken. Daher gelten für sie nicht so strenge Qualitätskriterien wie für die Qualitätsklasse A1. ENplus hat unter anderem für Großanlagen die Qualitätsklasse ENplus B eingeführt, womit auch hier für eine saubere Verbrennung gesorgt wird. Für ENplus-B-Pellets darf u.a. chemisch unbehandeltes Gebrauchtholz verwendet werden. Der Aschegehalt darf maximal 2 Prozent betragen. Ein Einsatz in privaten Kleinfeuerungsanlagen ist wegen des erhöhten Aschegehalts nicht zu empfehlen.
In Deutschland werden Industriepellets nur sehr selten eingesetzt.
IP
Englische Abkürzung für International Protection; Schutzgrad für elektrische Betriebsmittel; im Pelletlager mindestens IP 54 anwenden (geschützt gegen Staub in schädigender Menge; Spritzwasser geschützt).
Kaskade
In einer Kaskade werden zwei oder mehrere Pelletkessel oder Pelletsilos zu einem System zusammengeschaltet. Diese können je nach Wärmebedarf einzeln, gemeinsam oder im Wechsel die benötigte Wärmemenge bereitstellen. Ein ineffizienter Teillastbetrieb größerer Pelletkessel kann durch einen effizienten Volllastbetrieb von in Kaskade geschalteten kleineren Pelletkesseln vermieden werden. Für einen störungsarmen Betrieb sollten die Grundlastkessel regelmäßig gewechselt werden, damit sich die Laufzeit der einzelnen Anlagen angleicht. Für Wartungszwecke können einzelne Kessel außer Betrieb genommen werden, ohne dass die Wärmebereitstellung eingestellt werden muss. In der Regel werden Kaskaden eingesetzt, wenn ein einzelner Pelletkessel nicht die erwünschte Wärmeleistung erbringen kann oder wenn die benötigte Wärmemenge stark schwankt. Auch die Vorhaltung eines zweiten Kessels für den eventuellen Ausfall des anderen Kessels kann, was insbesondere bei größeren Anlagen für Mehrfamilienhäuser und Nichtwohngebäude von Bedeutung ist, ein Grund für die Installation einer Kesselkaskade sein.
Kessel
Kessel sind Wärmeerzeuger, in denen durch die Verbrennung von Brennstoffen Wasser erwärmt wird. Dieses Warmwasser kann dem Heizkreislauf zugeführt oder für den täglichen Bedarf verwendet werden. In der Regel dienen Kessel als Zentralheizung, oft in Kombination mit der Bereitstellung von Warmwasser.
Kleinfeuerungsanlagen
Kleinfeuerungsanlagen sind laut Festlegung in der sog. Kleinfeuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) Feuerung (Kessel oder Einzelraumfeuerungsanlagen) mit einer Leistung von bis zu 1.000 Kilowatt, die ohne Genehmigung errichtet werden dürfen. Die meisten Kleinfeuerungsanlagen bis max. 50 kW werden in Ein- und Zweifamilienhäusern eingebaut. Es gibt jedoch auch Kleinfeuerungsanlagen, die zur Beheizung von größeren Mehrfamilien- und Nichtwohngebäuden oder auch zur Bereitstellung von Prozesswärme eingesetzt werden.
Kleine und mittlere Lager
Pelletlager mit einem Fassungsvermögen von unter 30 t.
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird in einer Anlage gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Dadurch kann im Vergleich zur reinen Stromerzeugung die eingesetzte Energie sehr viel effizienter genutzt werden. Hauptvorteil ist dabei neben der Reduktion von CO2-Emissionen die Einsparung von Primärenergie. Gegenüber der reinen Wärmeerzeugung aus Brennstoffen in Kesseln steigt der Wirkungsgrad durch KWK – anders als vielfach angenommen – nicht, sondern sinkt in der Regel im zweistelligen Bereich. Dadurch ist KWK in der Regel nur als Ersatz von Kraftwerken sinnvoll – insbesondere dann, wenn dieser KWK-Strom gerade dann erzeugt wird, wenn nicht genügend Strom aus anderen Erneuerbaren Quellen erzeugt wird (sog. Regelenergie).
Kupplung/Storz-Kupplung
Verbindungsstück („Storz Typ A“, DN 100) am Stutzen und an den Schläuchen, um diese sicher miteinander zu verbinden.
Kurzumbetriebsplantage
Auf einer Kurzumtriebsplantage (KUP) werden schnellwüchsige Gehölze auf landwirtschaftlichen Flächen mit dem Ziel angebaut, Holz als nachwachsenden Rohstoff für die stoffliche Verwertung (langer Umtrieb) oder für die Energiegewinnung (kurzer Umtrieb) zu produzieren. Gepflanzt werden Bäume wie Pappeln und Weiden, die sich durch gute Wuchsleistung, Stockausschlag sowie schnelles Jugendwachstum auszeichnen. Alle drei bis sieben Jahre werden die Bäume geerntet und aus den verbleibenden Stöcken entsteht der Neuaustrieb für den nächsten Ertrag. Die so gewonnenen KUP – Holzhackschnitzel kommen vor allem zur Energiegewinnung in großen Anlagen über 1 MW Leistung (Hackschnitzelheizkraftwerke) zum Einsatz.
Lager
Das Lager ist bei einer Pelletzentralheizung besonders wichtig. Es muss eine stetige und reibungslose Förderung der Holzpellets durch ein Austragssystem gewährleisten. Für die Lagerung von Pellets gibt es verschiedene Möglichkeiten: Vorgefertigte Lagersysteme, individuell errichtete Pelletlager mit Schrägböden oder mit anderen Austragssystemen und Erdtanks. Die Anforderungen an ein Pelletlager werden in der Broschüre „Lagerung von Holzpellets“ kompakt mit vielen Bildern und Skizzen dargestellt. Qualifzierte Pelletfachbetriebe planen für Sie das optimale Pelletlager.
Lagerentnahme/Lageraustragung (Raumentnahme/Raumaustragung)
Die Lagerentnahme bzw. die Lageraustragung ist die automatische Entnahme und der automatische Transport der Holzpellets aus dem Pelletlager zur Pelletfeuerung. Sie erfolgt zumeist mechanisch mit einer (oder mehreren) Förderschnecke(n) oder einem Rührwerk oder pneumatisch mit einem Saugsystem (Saugentnahme).
Lagerraum
Ein Lagerraum ist ein Raum, in dem ein Pelletlager separat vom Heizraum untergebracht ist. In der Regel wird für die Lagerung von Holzpellets ein Kellerraum genutzt. Es können aber auch andere Räumlichkeiten, wie z. B. Garagen oder Dachböden, als Pelletlager dienen. In der Praxis hat sich ein rechteckiger Grundriss des Lagerraums als gut geeignet erwiesen.
Es kann aber auch ein Fertiglager in dem Lagerraum gestellt werden z. B. ein flexibles Pelletsilo.
Lamda-Sonde
Die Lambdasonde (λ-Sonde) ist ein Sensor, der den Sauerstoffgehalt im Abgas einer Verbrennung misst und diese so optimiert. Die elektronische Regelung eines Pelletkessels hält den Sauerstoffgehalt mit Hilfe des ermittelten Wertes in einem optimalen Bereich, indem sie die dem Verbrennungsvorgang zugeführte Luft- und Brennstoffmengen anpasst, z. B. durch Veränderung der Gebläsedrehzahl. Durch einen reduzierten Brennstoffbedarf lassen sich bis zu 30 Prozent Kosten sparen. Abweichungen in der Beschaffenheit der Holzpellets werden ebenfalls erkannt und berücksichtigt. Ein manuelles Umstellen der Anlage ist nicht erforderlich.
Lieferung
Die Lieferung loser Pellets erfolgt ähnlich wie bei einer Ölheizung mit einem speziellen Silofahrzeug. Über einen Befüllschlauch werden die Holzpellets staubarm und sauber in das Pelletlager eingeblasen. Im Durchschnitt reichen drei bis fünf Tonnen aus, um ein Einfamilienhaus ein Jahr lang zu beheizen. Besonders im Winter sollte der Liefertermin rechtzeitig im Voraus mit dem Händler vereinbart werden. Um längere Wartezeiten zu vermeiden und um die saisonal bedingt niedrigeren Preise zu nutzen, empfiehlt es sich, Pellets im Sommer zu bestellen. Das Zertifikat ENplus für Holzpellets kontrolliert die gesamte Lieferkette und gewährleistet so die einwandfreie Qualität der Pellets bis zur Anlieferung beim Kunden. Weiterführende Informationen auf der ENplus-Pellets-Webseite
Lignin
Lignin ist das holzeigene Bindemittel. Es kommt in sämtlichen holzartigen Pflanzen vor und verbindet deren Zellulosestrukturen. Das Lignin ist in der pflanzlichen Zellwand eingelagert und führt zur Verholzung der Zelle. Auch die Partikel in Holzpellets werden nach dem Pressen durch Lignin zusammengehalten. Als zusätzliche Bindemittel für die Produktion der Presslinge können bis maximal zwei Prozent pflanzliche Stärke eingesetzt werden. Weiterführende Informationen zur Pelletproduktion
Lose Pellets
Lose Pellets eigenen sich zur automatischen Beschickung von Pelletkesseln. Die Lieferung loser Pellets erfolgt mit speziell dafür konzipierten Silofahrzeugen. Die Holzsticks werden mit Luftdruck über einen Stutzen in das Pelletlager oder Pelletsilo eingeblasen. Gleichzeitig wird durch einen weiteren Stutzen Luft abgesaugt, um einen leichten Unterdruck im Lager zu erzeugen. Somit werden die Holzpellets leicht, schonend und staubarm eingetragen. Die ENplus-Zertifizierung für den Pellethandel stellt hohe Anforderungen, um eine sachgemäße Lieferung zu gewährleisten.
Mischpellets
Mischpellets sind Pellets aus mehreren Materialien wie Stroh oder Rapskuchen. Mischpellets haben mit Holzpellets für den Hausgebrauch nichts gemein und eignen sich nicht für die Verbrennung im Pelletkessel oder Pelletkaminofen. Aufgrund der verschiedenen Rohstoffe besteht die Problematik bei Mischpellets darin, eine schadstoffarme Verbrennung nach der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung zu gewährleisten.
Modulieren
Moderne Pelletfeuerungen sind in der Lage, ihren Leistungsbedarf automatisch anzupassen und zu regulieren (zu „modulieren“): Bei einem hohen Wärmebedarf wird der Kessel automatisch unter Volllast, also der höchst möglichen Wärmeleistung, betrieben. Ist der aktuell Wärmebedarf gering, wird die Pelletfeuerung im Teillastbetrieb betrieben, um nicht mehr Wärme zu liefern als benötigt. So wird auch ein Betrieb ohne Pufferspeicher möglich.
Nachhaltigkeit
Die ursprüngliche Grundidee der von der Forstwirtschaft entwickelten Nachhaltigkeit besteht darin, dass innerhalb eines Zeitraums von einer Ressource nur soviel verbraucht wird, wie sich regenerieren kann (sog. Mengennachhaltigkeit). Waldebesitzern wird durch das Bundeswaldgesetz vorgeschrieben, die Wälder nachhaltig zu bewirtschaften. Bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung müssen die Waldbestände einer Region in einem bestimmten Zeitraum gemeinsam betrachtet werden: Nur so kann die Fällung eines Baumes durch das Wachstum anderer Bäume mengenmäßig ausgeglichen werden. Würde man nur einzelne Bäume betrachten, könnte es keine Mengennachhaltigkeit geben. Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde seit seinen Ursprüngen jedoch erweitert. Moderne Definitionen enthalten neben ökologischen Aspekten auch noch weitere Aspekte. So kann eine bestimmte Wirtschaftsweise sowohl ökologisch, ökonomisch als auch sozial dauerhaft (also nachhaltig) betrieben werden (ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit). Holzpellets sind in mehrfacher Hinsicht eine nachhaltige Energieform: Der Rohstoff Holz wächst im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft immer wieder nach. Es werden gleichzeitig die Umwelt und das Klima geschützt sowie der Wirtschaftsfaktor Wald für zukünftige Generationen erhalten. Heimische Firmen schaffen mit der Produktion und dem Vertrieb von Holzpellets regionale Wertschöpfung, ersetzten damit den Import fossiler Brennstoffe und schaffen so zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort. Somit erfüllt der Energieträger Pellets in Deutschland alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit.
Nachtabsenkung
Die Nachtabsenkung ist die Reduzierung der Tagesheiztemperatur auf eine niedrigere Temperatur bei Nacht. In Wohnungen sind das etwa 16 Grad, in öffentlichen oder großen Bürogebäuden können es drei oder vier Grad weniger sein. Wie bei jeder anderen vollautomatischen Heizung kann die Nachtabsenkung in der Steuerung der Pelletheizung eingestellt werden. Doch nicht nur in der Nacht, sondern auch für beliebige andere Zeiträume lässt sich die Temperatur individuell einstellen. Je besser die Dämmung des Gebäudes, desto weniger steigert die Nachtabsenkung die Effizienz.
Nahwärme
Nahwärme ist eine Form der Fernwärme, bei der einzelne Gebäude, Gebäudeteile oder kleiner Wohnsiedlungen mit eigener Wärmeerzeugung erschlossen werden. Technisch und juristisch ist auch sie Fernwärme.
Nebenraum
Ein gut belüfteter Raum, der zur Belüftung von Pelletlagern zulässig ist. Der Raum sollte unmittelbar an das Lager grenzen. Es gelten dieselben Belüftungs- und Betretungsanforderungen wie für den Aufstellraum des Lagers.
Nennwärmleistung
Die Nennwärmeleistung (auch Nennleistung genannt) ist die maximale Leistung in Kilowatt (kW), die ein Wärmeerzeuger im Volllastbetrieb als Nutzenergie bereitstellen kann. Dieser Wert wird in Kilowatt (kW) angegeben und vom Hersteller auf dem Typenschild der Heizung ausgewiesen. Die richtig dimensionierte Nennwärmeleistung eines Heizkessels ist Voraussetzung für eine jederzeit ausreichende Wärmeversorgung eines Gebäudes. Sie ist aber auch wichtig, damit kein überdimensionierter Kessel eingebaut wird, der im Volllastbetrieb immer mehr Wärme liefert als benötigt wird. Die Nennwärmeleistung eines Wärmeerzeugers sollte daher der Heizlast entsprechen.
Niedrigstenergiegebäudestandard
Der Niedrigstenergiegebäudestandard ist der Energiestandard, den die EU-Mitgliedsstaaten gemäß Art. 9 der Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden (EPBD) Bauherren für ab 2021 neu errichtete private Gebäude und für ab 2019 neu errichtete öffentliche Gebäude vorschreiben müssen. Dabei handelt es sich laut Definition der EPBD-Richtlinie um ein Gebäude, das eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz aufweist, und dessen fast bei null liegender oder sehr geringer Energiebedarf zu einem ganz wesentlichen Teil durch Erneuerbare Energie gedeckt wird, die möglichst am Standort oder in der Nähe im Quartier erzeugt wird. Die Bundesregierung hat, den im Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten geltenden Standard zum Niedrigstenergiegebäudestandard erhoben. Er entspricht 55 Prozent des Primarenergiebedarfs und 100 Prozent des Wärmeverlustes des dort definierten Referenzgebäudes.
Niedrigenergiehaus
Als Niedrigenergiehaus bezeichnet man einen Energiestandard für Neubauten, aber auch sanierte Altbauten, der gewisse geforderte energietechnische Anforderungsniveaus unterschreitet. Dazu gehört eine energetisch effizient ausgeführte Wärmedämmung des Daches und der Außenwände, die dafür sorgt, dass die Leistung zur Beheizung gegenüber der anliegenden Außenlufttemperatur gering ausfallen kann. Eine einheitliche Festlegung über den Begriff Niedrigenergiegebäude gibt es in Deutschland nicht. Im Allgemeinen wird von Niedrigenergiegebäuden gesprochen, wenn der Energieverbrauch deutlich unter den rechtlich zulässigen Werten liegt. Das wäre in Deutschland weniger als der sog. Niedrigstenergiegebäudestandard des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Nutzungsgrad
Im Gegensatz zum Wirkungsgrad gibt der Nutzungsgrad einer Heizung das Verhältnis von Nutzenergie und Endenergie über einen Zeitraum hinweg an. Er berücksichtigt sämtliche Komponenten des Heizsystems, also die Wärmeerzeugung und -verteilung. Für die energetische Bewertung eines Heizkessels ist der Jahresnutzungsgrad die entscheidende Größe, da der Wärmebedarf von der Jahreszeit abhängt.
Oberer Abbrand
Heizungssysteme lassen sich nach der Art des Abbrandes – oberer und unterer Abbrand – unterscheiden. Der Unterschied besteht in der Art und Weise, wie ein Brennstoff abbrennt. Beim oberen Abbrand wird die Verbrennungsluft nicht durch einen Rost geleitet, sondern gelangt seitlich an den Bereich des Glutbetts. Die erste Brennstoffcharge wird von oben gezündet und auch das Glutbett befindet sich oben. Eine klassische Form des oberen Abbrandes ist zum Beispiel das Lagerfeuer.
Ökobilanz von Pellets
Eine Ökobilanz analysiert den gesamten Lebensweg eines Produktes von der Entstehung bis zur Entsorgung. Dabei erfasst die Ökobilanz die ökologischen Auswirkungen des Produktes auf die Umwelt. Das Heizen mit Holzpellets weist eine sehr gute Ökobilanz auf, da Holzpellets CO2-neutral verbrennen und nur die bei der Bereitstellung des Brennstoffs zwischen Wald und Pelletwerk verbrauchte fossile Energie als CO2-Emission zu Buche schlägt. Diese fällt im Durchschnitt deutlich niedriger aus als bei der Bereitstellung fossiler Energieträger. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen zeichnen sich Pelletfeuerungen daher durch einen sehr geringen CO2-Ausstoß aus. Weiterführende Informationen zu Klima und Umwelt
Ölheizungsverbot
On-Board-Wiegesystem
Partikelabscheider
Partikelabscheider werden verwendet, um Staub im Abgas zu mindern. Die Nachrüstung eines Partikelabscheiders kann bei Bestandsanlagen eine Lösung sein, die bei Praxismessungen den nach Ablauf der Übergangsfrist verschärften Staubgrenzwert der 1. Stufe der 1. BImSchV tatsächlich oder in Zukunft eventuell nicht einhalten können. Im Neubau können sie eingesetzt werden, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage den Staubgrenzwert der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht einhalten kann, weiter abzusenken. Dies erfolgt besonders häufig bei Hackschnitzelkesseln. Oft werden Partikelabscheider auch bei der Installation in Neubauten eingebaut, vor dem Hintergrund, dass im Neubau nur Feuerungen mit Brennwerttechnik oder Partikelabscheider staatlich gefördert werden.
Pelletfachbetrieb
Qualifizierte Heizungsbauer, die an einer Fachschulung des DEPI teilgenommen haben, dürfen sich Pelletfachbetrieb nennen. In den Schulungen erhalten die Betriebe Informationen zu Produktion, Handel und Qualität von Holzpellets wie auch zur Lagerraumgestaltung und Brandschutz. Des Weiteren muss der Betrieb die Planung und den Einbau von mindestens fünf Pelletheizungen sowie eine Technikschulung nachweisen. Die Auszeichnung muss alle drei Jahre erneuert werden, so dass Pelletfachbetriebe stets auf dem neuesten Stand in Sachen Pellets sind. Die Auszeichnung „Pelletfachbetrieb“ ist eine gemeinsame Initiative des DEPI, des ZVSHK sowie den SHK-Fachverbänden in den Ländern. Spezialisten für Pellet- und Holzfeuerungen per Postleitzahlsuche.
Pelletfeuerung
Mit dem Begriff Pelletfeuerung werden die verschiedenen Arten von Feuerungen, die mit Holzpellets als Brennstoff betrieben werden, zusammengefasst. Dies sind v.a. Pelletkessel und Pelletkaminöfen. Aber auch Pellet-KWK-Anlagen, die neben Wärme auch Strom erzeugen, und Pellet-Warmluftheizungen/ -öfen, die warme Luft statt Wasser als Wärmeüberträger erzeugen, gehören dazu.
Pelletkaminöfen
Pelletkaminöfen werden im Wohnraum aufgestellt. Sie beheizen hauptsächlich den Aufstellraum und gehören daher zu den sog. Einzelraumfeuerungen. Da sie Teil der Einrichtung sind, spielt das Design bei ihnen eine große Rolle. Pelletkaminöfen werden in der Regel per Hand aus handlichen 8-15 kg-Säcken befüllt und halbautomatisch betrieben. Es ist auch die vollautomatische Betriebsweise möglich, benötigt jedoch ein Pelletlager (auch Pelletsilo) sowie eine automatische Lagerentnahme/Lageraustragung. Pelletkaminöfen können luftgeführt oder wassergeführt betrieben werden. Luftgeführt geben sie in der Regel nur Strahlungswärme an den Aufstellraum ab. Wassergeführt besitzen sie eine sogenannte Wassertasche bzw. einen Wärmeübertrager, sodass überschüssige Wärme in das Wärmeverteilsystem des Gebäudes eingespeist und die Zentralheizung unterstützt bzw. Warmwasser bereitgestellt werden kann. Sie haben den Vorteil, dass sie mit Pufferspeicher zu einer Hybridheizung kombiniert werden können – z. B. mit einer Solarthermieanlage.
Pelletkessel
Ein Pelletkessel ist eine vollautomatische Feuerung/Heizung, die Holzpellets als Brennstoff nutzt und dabei Wärme erzeugt, die in einem Wärmeübertrager auf Wasser übergeben wird. Auf dem Markt sind Anlagen erhältlich, die niedrige einstellige Kilowatt (kW) als Wärmeleistung bereitstellen können, bis hin zu Anlagen mit mehreren Megawatt (MW). Pelletkessel können so von der Gebäudewärme bis hin zur Prozesswärme ein breites Spektrum an Wärme bereitstellen. Die vielseitigen Einsatzbereiche von Pelletkesseln reichen je nach Nennwärmeleistung über Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser über Nichtwohngebäude (z.B. Schulen und Kitas) bis hin zur gewerblichen Wirtschaft (Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie) und zum großen Stadion, wie das vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim.
Pelletmarkt
Der deutsche Pelletmarkt setzt sich aus ca. 40 Pelletproduzenten, die über 50 Werke betreiben, sowie rund 700 Händlern zusammen. Diese hohe Konkurrenz führt zu einer den Marktgesetzen folgenden funktionierenden Preisbildung. Durch die klein- bis mittelständischen Betriebe in der Region kommt es zu einer hohen Markttransparenz. Die Vielzahl an Produzenten und Lieferanten ermöglicht zudem den regionalen Ein- und Verkauf des Brennstoffs. So unterstützt der Verbraucher beim Heizen mit Holzpellets Unternehmen in seinem näheren Umfeld und schafft Arbeitsplätze in seiner Region.
Pelletzentralheizung
Eine Pelletzentralheizung ist eine Zentralheizung, die mit Holzpellets befeuert wird. Mit ihr werden nicht nur einzelne Räume, sondern meist das ganze Gebäude. In der Regel ist dies ein Pelletkessel, kann aber auch ein wasserführender und in seltenen Fällen auch ein luftführender Pelletkaminofen sein.
Pneumatisches Austragssystem
Saugentnahme wie z. B. der A.B.S. Vacueplletsauger. Damit werden Pellets durch Unterdruck aus dem Pelletlager abgesaugt: Dies kann sowohl von unten durch Saugsonden oder von oben durch einen Saugkopf erfolgen.
Prallmatte
Die Pellet-Prallmatte sorgt im Lager dafür, dass die Holzpellets während der Lieferung schonend eingebracht und der Pelletstrom nach dem Aufprall nach unten abgeleitet wird. Des Weiteren schützt sie auch die Wand selbst. Die Prallmatte ist etwa 1,2 x 1,5 m groß und besteht aus einem abriebfesten und altersbeständigen Kunststoff (z.B. HDPE- oder EPDM-Folie) mit einer Befestigungsmöglichkeit für die Deckenmontage und einer Abspannmöglichkeit nach unten. Sie wird gegenüber dem Befüllstutzen bei einer Flugstrecke von 5 m mit einem Abstand von mindestens 20 cm zur Wand angebracht. Bei einer Flugstrecke von 2 m sollten es 50 cm sein.
Pressung
Bei der Pelletproduktion werden Sägespäne mit großem Druck durch eine Matrize gepresst. Die dabei entstehenden hohen Temperaturen setzen holzeigenes Lignin frei und bringen es zum Schmelzen. Diese organische Verbindung wirkt wie ein natürlicher Klebstoff und verhindert das Auseinanderbröseln der verpressten Sägespäne. Wenn das geschmolzene Lignin beim Abkühlen aushärtet, bildet es die für Holzpellets typische glatte, glänzende Oberfläche.
Primärenergie
Primärenergie ist Energie, wie sie in den natürlich vorkommenden Formen oder Energiequellen zur Verfügung steht. Hierzu gehören Primärenergieträger wie Stein- und Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Uran, Wasserkraft, Sonnenstrahlung, Windkraft, Erdwärme, Gezeitenenergie und Holz. Im Gegensatz zu endlichen fossilen Energiequellen werden Erneuerbare Energieformen wie Holz oder Sonnenenergie immer wieder neu bereitgestellt, ohne zu versiegen. Diese Primärenergie wird in vom Verbraucher nutzbare Endenergieträger umgewandelt (z. B. Strom, Heizöl, Holzpellets). Da dieser Vorgang mit Verlusten behaftet ist, kann die im Primärenergieträger enthaltene Energiemenge nicht gänzlich genutzt werden. Je nach Energieträger und eingesetzter Umwandlungstechnik sind diese Verluste unterschiedlich hoch.
Primärenergiebedarf
Der Primärenergiebedarf ist gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) der rechnerisch aus den technischen Eigenschaften des Gebäudes und der Heizungsanlage ermittelte Bedarf an fossiler Primärenergie, die für die Beheizung und Warmwasserbereitung eines Gebäudes benötigt werden. Im Primärenergiebedarf inbegriffen sind auch die Energieverluste außerhalb des betrachteten Gebäudes, die bei der Bereitstellung der im Gebäude verwendeten Endenergie auftreten. In Energieausweisen für Wohngebäude muss in Neubauten der Primärenergiebedarf ausgewiesen werden, da ja noch keine Verbrauchsdaten vorliegen können. Erst in Bestandsgebäuden kann wahlweise entweder der Primärenergiebedarf oder der Primärenergieverbrauch angegeben werden.
Primärenergie
Jedem Endenergieträger wird ein Primärenergiefaktor zugeordnet. Er ist das Verhältnis aus Primärenergie und Endenergie, drückt also aus, wie viel Primärenergie für die Erzeugung von Endenergie aufgewendet werden muss. Dieser Faktor wird in den erneuerbaren und den nicht-erneuerbaren Anteil unterteilt. Der Primärenergiebedarf bzw. der Primärenergieverbrauch eines Gebäudes lässt sich gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) berechnen, indem der Endenergiebedarf bzw. Endenergieverbrauch eines Gebäudes mit dem Primärenergiefaktor (nicht erneuerbarer Anteil) des Endenergieträgers multipliziert wird. Dadurch umfasst der Primärenergiebedarf bzw. der Primärenergieverbrauch gemäß EnEV nur den Verbrauch bzw. Bedarf an fossilen Primärenergieträgern.
Primärenergieträger
Der Primärenergieträger ist der in der Natur in ihrer ursprünglichen Form vorliegende Energieträger, z.B. Steinkohle, Rohbraunkohle, Erdöl, Erdgas, Holz, Kernbrennstoff, Wasserkraft, Sonnenstrahlung und Wind, die zum Teil nicht direkt genutzt wird bzw. genutzt werden kann, sondern vielfach erst noch in Endenergieträger (z.B. Heizöl, Braunkohlebriketts, Holzpellets oder Brennholz) umgewandelt wird bzw. werden muss.
Primärenergieverbrauch
Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist der Primärenergieverbrauch im Unterschied zum berechneten und vom Nutzerverhalten unabhängigen Primärenergiebedarf der tatsächliche, vom Nutzerverhalten abhängige Verbrauch an fossiler Primärenergie. Er kann in Energieausweisen nur bei Bestandsgebäuden, nicht aber bei Neubauten angegeben werden.
Pufferspeicher
Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung von Holzpellets ist wichtig, da die Pelletqualität den Ausschlag für die einwandfreie Funktion der Heizung gibt. In Deutschland gewährleistet die ENplus–Zertifizierung die einwandfreie Qualität des Brennstoffs. Das Zertifikat ENplus überprüft die gesamte Handelskette vom Pelletwerk bis zum Verbraucher, damit die hochwertig produzierten Pellets auch im Lager des Kunden noch die geltenden Qualitätsnormen erfüllen.
Quereinschubfeuerung (auch Seiteneinschubfeuerung)
Holzpelletheizungen arbeiten mit unterschiedlichen Techniken der Beschickung. Eine davon ist die Quereinschubfeuerung, bei der der Brennstoff seitlich in die Brennkammer geführt wird. Der Brennstofftransport erfolgt mittels Förderschnecke oder Kolben. Die Brennkammer ist dabei meist als Rostfeuerung konstruiert.
Rohdichte
Die Rohdichte eines Brennstoffs beschreibt, wie hoch seine Masse pro Volumeneinheit ist. Sie wird in g/cm3 angegeben und ist der Quotient aus der Masse eines Körpers und seinem Volumen, einschließlich aller Hohlräume (bei Holz z. B. Poren und Gefäße). Die Rohdichte beeinflusst die Schüttdichte von Holzpellets und einige feuerungstechnisch relevante Eigenschaften (zum Beispiel die Entgasungsrate). Eine hohe Rohdichte bedeutet auch eine hohe Energiedichte. Durch den Pressvorgang beträgt die Rohdichte von Pellets über 1,12 kg/dm³ und ist damit um ein Vielfaches höher als die von Sägespänen oder von Stückholz. Während bei Holzbriketts die Rohdichte eine Anforderung der ENplus–Zertifizierung ist, wird bei dem Schüttgut Pellets stattdessen die Schüttdichte überwacht.
Rohstoff in der Pelletproduktion
Zur Herstellung von Holzpellets wird als Rohstoff ausschließlich naturbelassenes Holz verwendet, das frei von chemischen Zusätzen ist. Dies sind vor allem die in der Säge- und Hobelindustrie anfallenden Nebenprodukte wie Sägespäne, Hobelspäne oder Hackschnitzel (meist über 90 Prozent).
Rührwerk
Fördersystem zur Austragung von Holzpellets aus dem Lager. Durch sich drehende Stahlfedern am Boden des Lagers werden die Pellets einer Schnecke zugeführt. Der weitere Transport zur Feuerung kann mit einer Schnecke oder einer Saugförderung erfolgen.
Rückbrandsicherung
Eine Rückbrandsicherung zum Pelletlager ist notwendig, damit sich das Feuer aus dem Brennraum des Heizkessels nicht über das Austragssystem in das Lager ausbreiten kann. Hierfür stehen verschiedene Vorrichtungen zur Auswahl.
Sackware
Eine Rückbrandsicherung zum Pelletlager ist notwendig, damit sich das Feuer aus dem Brennraum des Heizkessels nicht über das Austragssystem in das Lager ausbreiten kann. Hierfür stehen verschiedene Vorrichtungen zur Auswahl.
Sägenebenprodukte
Als Sägenebenprodukte (SNP) werden in der holzverarbeitenden Industrie alle Holzreste bezeichnet, die beim Einschnitt und der Verarbeitung von Sägeholz in Sägewerken entstehen. Diese Nebenprodukte sind beispielsweise Sägespäne, Hobelspäne oder Hackschnitzel. Bis zu 40 Prozent eines Baumstamms fallen in Form von Sägenebenprodukten an. Nur 60 Prozent können in Form von Brettern oder Kanthölzern als Schnittware verwendet werden.
Sägespäne
Sägespäne (oder auch Holzspäne) sind bei der Verarbeitung von Holz anfallende Reststoffe, die stofflich oder energetisch genutzt werden können. Die stoffliche Nutzung erfolgt beispielsweise in der Holzwerkstoff-Industrie, die energetische Nutzung in Form von Holzpellets oder Briketts. Sie entstehen beim Sägevorgang im Sägewerk oder beim Hobeln von Holz in Schreinereien und der Möbelindustrie.
Saugentnahme
Die Saugentnahme (auch Saugaustragung) ist ein pneumatisches Austragsystem, das die Holzpellets aus dem Pelletlager in den Heizkessel befördert. Es gibt zwei Varianten der Saugaustragung, einerseits die Saugentnahme von oben und andererseits die Saugentnahme von unten. Saugsysteme kommen bevorzugt zum Einsatz, wenn der Lagerort der Pellets weiter vom Kessel entfernt ist, denn sie ermöglichen eine Zuführung bis circa 20 Meter Entfernung und können etwa fünf Höhenmeter überbrücken.
Saugkopf
Einrichtung zur Saugentnahme von oben.
Saugsonde
Beispielweise wie die Saugsonden von A.B.S. Diese dient als Verlegeweg für den Befüllschlauch, der möglichst kurz und ohne Bögen sowie frei von Hindernissen sein sollte. Der Schlauchweg der Absaugung unterscheidet sich von dem der Befüllung.
Schnecke/Förderschnecke
Fördersystem zur Austragung von Holzpellets aus dem Lager. Weiterer Transport zur Feuerung kann mit einer Schnecke oder einer Saugförderung erfolgen. Unterscheidung in Schnecke mit Seele (starre Schencke) und seelenlose Schnecke (flexibel). Der Abstand der Wendeln sollte zum Motor größer werden und somit eine Steigung aufweisen. Schneckenkanäle sollten ohne Hindernisse oder Verengungen sein. Druckentlastung für die Schnecke sollte vorgesehen werden.
Schrägboden
Schräger glatter Einbau, wird im Schrägbodenlager verwendet.
Staubdicht
Staubdichte Abtrennung des Lagers (Wände, Einstiegs- (Austragsöffnungen) zum Wohn- und Arbeitsbereich. Abdichtung der Saugsystemschläuche gegen Unterdruck notwendig.
Schüttdichte
Die Schüttdichte ist die Masse eines Schüttguts (z.B. Pellets, Hackschnitzel) bezogen auf das geschüttete Volumen einschließlich der Hohlräume. Die Schüttdichte ist abhängig von der Längenverteilung und in geringerem Maße von der Rohdichte. Die Schüttdichte von Holzpellets darf laut ENplus–Zertifizierung zwischen 600 und 750 kg/m³ liegen. Sie hat Auswirkungen auf das Brennverhalten im Kessel und wie viel Energie bei gleicher Füllmenge gelagert werden kann.
Temparaturfühler
Der Temperaturfühler misst die Wassertemperatur im Pufferspeicher und meldet sie an die zentrale Regelung der Pelletfeuerung. Bei Bedarf belädt die Feuerung den Pufferspeicher, so dass das benötigte Temperaturniveau im Speicher wiederhergestellt wird. Ebenso werden Temperaturfühler im Brennraum der Feuerung eingesetzt, um die korrekte Verbrennungstemperatur einzustellen.
Trocknung von Holzpellets
Für die Herstellung von Holzpellets ist oftmals die Trocknung des Rohmaterials Späne (siehe Rohstoff) notwendig. Frisches Holz weist einen Wassergehalt von bis zu 60 Prozent auf. Die Trocknung auf weniger als zehn Prozent Wassergehalt erhöht den Heizwert von unter 2 kWh/kg auf bis zu 5 kWh/kg. Damit werden ideale Voraussetzungen für eine effiziente Verfeuerung erreicht.
Unterer Abbrand
Beim unteren Abbrand breiten sich die Flammen unterhalb des Feuerraumbodens oder zur Seite hin aus. Dadurch nimmt nur die jeweils unterste Schicht der Holzpellets an der Verbrennung teil. Die Brenngase werden über einen mechanischen Lüftungszug nach unten oder zur Seite abgeleitet. Die über das Glutbett verbleibenden Holzpellets dienen als Brennstoffreserve, die während des Abbrands selbstständig nachrutschen und so für einen kontinuierlichen Nachschub sorgen. Vorteil dieser Technik ist, dass bei großem Füllraumvolumen Feuerungen seltener nachgefüllt werden müssen.
Unterschubfeuerung
Bei einer Unterschubfeuerung wird der Brennstoff mit einer Förderschnecke von unten in die Brennermulde (Retorte) eingeschoben und dort verbrannt. Aufgrund der Beschickung des Brennraums mit einer Förderschnecke eignen sich Unterschubfeuerungen für aschearme Brennstoffe wie Holzpellets mit einer feinkörnigen und homogenen Beschaffenheit, und kommen deshalb auch bei Pellet-Zentralheizungen zum Einsatz. Darüber hinaus gibt es auch Seiten- bzw. Quereinschubfeuerungen.
Verbrennung
Die Verbrennung ist eine Reaktion eines Materials mit Sauerstoff oder einem anderen Gas, die unter Abgabe von Energie in Form von Wärme und Licht abläuft. Dabei wird die in den organischen (brennbaren) Bestandteilen des Brennstoffes gebundene chemische Energie durch Oxidation mit Sauerstoff in Wärme umgewandelt. Die anorganischen (nicht brennbaren) Bestandteile der Holzpellets bleiben als Asche übrig. Bei der Verbrennung von zertifizierten Pellets liegt der Ascheanteil bei 0,7 Prozent.
Versintung
Bei hohen Temperaturen im Glutbett und/oder durch Verringerung der Ascheerweichungstemperatur (insbesondere aufgrund von Verunreinigungen des Brennstoffs) kann Asche erweichen oder sogar flüssig werden. Es entsteht Versinterung. Erkaltet die versinterte Masse, erstarrt sie und bildet Ablagerungen, was zu Betriebsstörungen führen kann: Die Ablagerungen beeinträchtigen zunehmend die Zufuhr von Primärluft und damit die Qualität der Verbrennung. Die ENplus–Zertifizierung setzte erstmals Grenzwerte für die Ascheerweichungstemperatur fest. Für Holzpellets der Qualität A1 gilt: Bei Verbrennungstemperaturen unter 1.200 Grad sollte es nicht zu Versinterung kommen. Um der Bildung von verklumpter Asche und Ablagerungen vorzubeugen, besitzen in der Regel alle Pelletfeuerungen ein Programm für die automatische Reinigung des Brennerrostes.
Versorgungssicherheit
2019 wurden in Deutschland 2,4 Millionen Tonnen Holzpellets jährlich verbraucht. Die Produktionskapazität lag bei 3,9 Millionen Tonnen, während sich die Produktion auf knapp 2,8 Millionen Tonnen Holzpellets belief. Es werden in Deutschland also mehr Pellets hergestellt als verbraucht werden. Ein bedeutender Anteil der hierzulande hergestellten Pellets wird daher exportiert. Auch ist die Kapazitätsgrenze für die Pelletproduktion noch lange nicht erreicht. Der für die Herstellung notwendige Rohstoff ist auch bei einer weiteren Zunahme installierter Pelletheizungen ausreichend vorhanden. Bei Bedarf könnte auch noch mehr Holz aus deutschen Wäldern genutzt werden, denn Ressourcen sind genügend vorhanden.
Vollautomatische Feuerung
Bei einer Pelletfeuerung, bei der nicht nur die Beschickung des Brennraums mit dem Brennstoff automatisch erfolgt, sondern bei der die Holzpellets auch automatisch aus einem Pelletlager zur Feuerung transportiert werden (Lagerentnahme/Lageraustragung), wird von einer vollautomatischen Feuerung gesprochen. Dies ist bei einem Pelletkessel der Standardfall.
Volumen von Holzpellets
Das Volumen wird in der physikalischen Einheit m³ (Kubikmeter) angegeben und beschreibt den Rauminhalt eines Mediums. Eine Tonne Holzpellets hat ein Volumen von ca. 1,54 m³, das heißt ein Kubikmeter Holzpellets wiegt ca. 650 Kilogramm.
Vorrat von Holzpellets
Es empfiehlt sich im Sommer Holzpellets zu bevorraten. Dabei sollte mindestens alle zwei Jahre vorher das Lager leer gefahren und gesäubert werden. Kunden profitieren von attraktiven Sommerpreisen und sind so für die Heizsaison gut gerüstet.
Wärmeübertrager
Der Wärmeübertrager ist eine Komponente des Heizkessels bzw. Ofens. Er umgibt die Brennkammer und besorgt die Wärmeübertragung an das Heizmedium Luft oder Wasser (luftgeführt oder wassergeführt). Bei Öfen unterstützt ein Gebläse die Wärmeübertragung an die Umgebungsluft. Bei Kesseln ist eine Umwälzpumpe zur Wasserzirkulation im Heizkreis vorhanden. Früher wirkten die Ofenoberfläche und das Ofenrohr als Wärmeübertrager. Moderne Pelletkessel verfügen über eine selbstständige Reinigung des Wärmeübertragers, die dafür sorgt, dass sich keine Flugasche auf der Oberfläche der Überträgerrohre absetzt. Somit kann ein ungestörter Wärmeaustausch bei gleichbleibender Effizienz stattfinden.
Waldrestholz
Waldrestholz bezeichnet in der Forstwirtschaft die Holzreste, die bei einem professionellen Holzeinschlag oder bei Pflegemaßnahmen, bei denen abgestorbene, schwache oder fehlgewachsene Bäume dem Wald entnommen und sog. Zukunftsbäume freigestellt werden, anfallen. Meist verbleiben diese Reste im Wald, insbesondere auf nährstoffarmen Standorten dienen sie der Regeneration des Waldbodens, da die Nährstoffe durch Kompostierung zurück in den Waldboden übergehen. Zudem wird Waldrestholz auch zu Hackschnitzeln verarbeitet und energetisch genutzt. Waldrestholz besteht überwiegend aus Baumkronen, Ästen und nicht verkaufbaren Stammteilen. Waldrestholz unterscheidet sich damit von Sägenebenprodukten, die mit Ausnahme der Rinde alle Nebenprodukte umfassen, die in Sägewerken anfallen. Waldrestholz ist als Rohstoff für Holzpellets nicht gut geeignet, weil es viel Rinde und damit Asche enthält.
Wassergehalt von Holzpellets
Der Wassergehalt bezeichnet den prozentualen Anteil des Wassers in Bezug auf die gesamte Holzmasse (also mit Wasseranteilen) und ist bei Holzbrennstoffen ein zentraler Parameter bei der Beurteilung der Brennstoffqualität. Nur wenn der Wassergehalt auf die Bedürfnisse der Heizanlage abgestimmt ist, kann sie emissionsarm und störungsfrei betrieben werden. Je weniger Wasser Brennstoffe enthalten, desto abgasärmer und rußfreier läuft die Verbrennung ab. Der Wassergehalt ist, anders als der Feuchtegehalt, die ausschlaggebende Größe bei der Zertifizierung von Holzpellets und Hackschnitzeln. Bei nach ENplus zertifizierten Pellets darf der Wassergehalt nur maximal 10 Prozent betragen. Die aktuelle Version des ENplus Hackschnitzel-Handbuchs (V. 1.0) definiert den maximalen Wassergehalt für die Qualitätsklassen ENplus A1 (≥ 8 % bis ≤ 25 %) und ENplus A2 (≤ 35 %). Bei Hackschnitzeln der Qualitätsklasse ENplus B muss der gemessene Wassergehalt angegeben werden. Wassergehalt = Gewicht des Wassers / Gewicht des Holzes (mit Wasser) Weiterführende Informationen zu den Eigenschaften auf der ENplus-Pellets-Webseite Weiterführende Informationen zu dem Holzpellet-Feuchtemessgerät im DEPI-Shop Weiterführende Informationen zum Wassergehalt bei Hackschnitzeln inklusive Hackschnitzelrechner auf der ENplus-Hackschnitzel-Webseite
Zentralheizung
Eine Zentralheizung sorgt für die Energieversorgung von Räumen oder Gebäuden aus einer Heizzentrale, die meist im Keller liegt. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Grundprinzip ist jedoch immer gleich: Als Übertragungsmedium dient Wasser, das durch Rohrleitungen in die einzelnen Räume gelangt und dort über Heizkörper oder Flächenheizungen die Wärme an die Luft abgibt. Alle Pelletkessel sind Zentralheizungen, Pelletkaminöfen versorgen hingegen meist nur einen oder wenige Räume und werden daher als Einzelraumfeuerstätte bezeichnet.
Zertifizierte Pellets
Zertifizierte Pellets wurden durch eine Prüfstelle auf Qualitätsanforderungen von Normen und Zertifizierungen kontrolliert. Jeder zertifizierte Hersteller bzw. Händler muss sich an die Auflagen des Prüfsiegels halten, um einwandfreies und energieeffizientes Heizen zu ermöglichen. Die Anforderungen an Holzpellets sind in der international gültigen Norm DIN EN ISO 17225-2 festgelegt. Sie werden im Zertifizierungsprogramm ENplus für den Verbraucher umgesetzt. Bei einigen Eigenschaften gehen die Anforderungen von ENplus sogar über die Vorgaben der Norm hinaus.
Zyklonabscheider